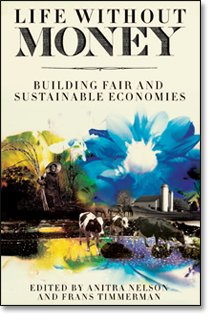Commons-based peer production braucht ein Commoning, also eine Form von Selbstorganisierung um Gemeingüter nicht-kommerziell und bedarfsgerecht zu verwalten. Dieser Artikel möchte einen Beitrag leisten zur Erkundung wie diese Organisierung konkret aussehen könnte: Zum einen an einer Reflektion über ein Experiment “Solidarischer Landwirtschaft” und zum anderen an konkreten Überlegungen wie ein Commoning rund um endliche Ressourcen aussehen könnte. Die Artikel finden sich auch in der aktuellen Ausgabe der “Streifzüge” und dem soeben erschienenden Büchlein “Herrschaftsfrei Wirtschaften”.
Die post-revolutionäre Möhre. Hier und Jetzt.
Ein Bericht aus einem Versuch solidarischer Landwirtschaft auf dem Weg zur Schenkökonomie
Wir, ein Kollektiv von fünf „Gärtner_Innen“, suchten uns eine Gruppe von 60 Personen, die „Begärtnerten„, die von uns durch die Bearbeitung von 5000 qm Ackerfläche im nordhessischen Witzenhausen-Freudenthal mit Gemüse von April bis November versorgt werden wollten. Zusammen formten wir eine verbindliche Gemeinschaft.
Wann und wieviel wir Gärtner_Innen in diesem Projekt arbeiten, nein besser, tätig sein wollen, wurde von jedem einzelnen selbstverantwortlich und je nach Bedürfnissen (flexibel) festgelegt und im Kollektiv vereinbart. Der Teil unserer finanziellen Bedürfnisse („Lohn“), der über das Projekt befriedigt werden soll, wurde weitgehend unabhängig von dieser Tätigkeitszeit bestimmt und mit den laufenden Betriebskosten (ohne Investitionen) zu den Gesamtkosten (Budget) einer Jahresproduktion zusammengerechnet.
Die Begärtnerten boten dann anonym einen auf den Zeitraum der Produktion verbindlichen, monatlichen finanziellen Beitrag, der ihren Möglichkeiten entspricht. Von 0 Euro aufwärts war und ist alles möglich. Diese Zusage und andere Punkte (Entscheidungsfindung, Ausstiegsgründe, Scheiterkriterien, gemeinsame Übernahme von Verantwortung und Risiko, Kommunikation etc.) wurden in einer Vereinbarung schriftlich und verbindlich festgehalten und unterschrieben. Das zuvor beschriebene Budget wurde mit diesen freiwilligen finanziellen Beiträgen gedeckt, woraufhin der genaue Bedarf an Gemüse abgefragt und mit der Produktion des Gemüses begonnen wurde.
Die Ernte wird der Gemeinschaft von Begärtnerten in Depots frei zur Verfügung gestellt. Die Verteilung vor Ort organisiert die Gemeinschaft je nach den individuellen Bedürfnissen. Es gibt keine genormten „Gemüsekisten“, sondern jede_r nimmt, was gebraucht wird. Ein weiteres Mitwirken am Projekt durch Mitarbeit, Erntesicherung/Einmachen und das Einbringen von weiteren Fähigkeiten steht den Mitgliedern frei, ist aber erwünscht und wird gemeinsam organisiert.
Durch dieses Experiment sollen kapitalistische Prinzipien in unserem Verhältnis zueinander überwunden und transformiert werden:
Freiwilliges Beitragen und Schenken statt Tausch, Wert, Ware
- Niemand muss, alle können nach ihren Fähigkeiten (u.a. finanziell) beitragen.
- Bedürfnisse werden erhoben und ihnen entsprechend wird produziert. Daher werden den Leuten keine Waren mehr vor die Füße geschmissen, für die sie dann doch bitte auch ein Bedürfnis haben sollen; sondern Bedürfnisse werden formuliert und die Produktion wird dafür selbst organisiert.
- Die Produkte haben keinen Tausch- bzw. Geldwert. Damit werden Dinge nicht abstrakt gleichgesetzt wie im Kapitalismus: Alles, was 1 Euro kostet, ist gleich viel „wert“. Alles, was nix kostet, ist nix „wert“.
- Daher entfällt Geld als primäre Wertschätzung und es kann mit neuen Formen der Wertschätzung experimentiert werden; durch Worte, Gesten und vor allem gegenseitige Verantwortung.
Freies Tätigsein statt abstrakter Arbeit in Konkurrenz:
- Tätigkeit wird zu Arbeit und Arbeit zur Last, wenn unsere Produkte auf dem Markt einen Wert erzielen müssen oder wir primär für einen Lohn arbeiten.
- In unserem Projekt müssen wir beides nicht: Wir liefern keine normierten Waren und unsere finanziellen Bedürfnisse werden von vornherein abgedeckt.
- Daher können wir Anbauweise und Arbeitsabläufe frei bestimmen, um unsere und die Bedürfnisse anderer Menschen zu befriedigen.
- Kommt es zu Problemen, lösen wir diese nicht wie in der Gesellschaft der Vereinzelten mit dem Ellenbogen und dem „Ausschalten von Konkurrenten“ sondern durch kollektive Lösungsfindung.
Knapp 11 Monate nach Beginn des Projektes haben sich allerdings einige Problemfelder in unserem Projekt aufgetan. Deren Analyse halte ich für wichtig, wenn Projekte über die Waren- und Tauschgesellschaft hinausweisen wollen:
Problemfeld 1: Der verinnerlichte Kapitalismus im Kollektiv
Das Problemfeld betrifft vor allem uns als Kollektiv von Gärtner_innen. Was Tausch und Geld im Kapitalismus so hervorragend machen, nämlich Menschen und Tätigkeiten zu vergleichen und gleichzusetzen, verschwindet in einem weniger kapitalistischen System nicht sofort. Diese Verhaltensweisen scheinen wir tief verinnerlicht zu haben. Wir, also einmalige Individuen, die im Kollektiv zusammenarbeiten, vergleichen weiterhin, wieviel Zeit wir in das Projekt investieren. Wir bekommen ein schlechtes Gewissen, weil wir „zu wenig“ tun, oder werden grummelig, weil wir „zu viel“ tun. Schnell kommt es zu Situationen, in denen wir uns für unsere Bedürfnisse (die ja so sind wie sie sind) rechtfertigen wollen, oder denken, dass wir es müssen. Oft ist es gar nicht das Kollektiv, das diesen Druck erzeugt, sondern wir, die Individuen selbst. Denn schließlich ist unser Kopf vom allgegenwärtigen Kapitalismus vollkommen durchzogen.
Eine schnelle Abhilfe für das Problem scheinen die üblichen Abstraktionen des Kapitalismus zu bieten. So geschieht es beizeiten auch in unserem Kollektiv: Ein Ruf nach einer Abstraktion der Zeit in greifbare „Arbeitsstunden“ oder „Urlaubszeiten“ wird laut. Und darauf aufbauend: Das Verlangen nach einem abstrakten Gerechtigkeitsbegriff. Statt zu sagen: „Es soll allen gut gehen mit dem, was und wieviel sie tun“, sagen wir schnell: „Alle sollen das gleiche Maß an Arbeit verrichten bzw. die gleiche Anzahl an Urlaubswochen haben“. Nicht nur, dass 1 Stunde an 1 Tag sich anfühlen kann wie 8 Stunden an einem anderen. Nein, wer Arbeitsstunden normieren will, ist auch schnell dabei, die ganze Tätigkeit zu normieren: Was zählt als Arbeitszeit? Welche Tätigkeit ist wichtig, welche nicht? Was, wenn eine Person schneller oder „effizienter„ (was ist das?) arbeitet als die andere? Diese Fragen und Probleme und die Erkenntnis, dass es statt Gleichmacherei darum gehen sollte, dass sich alle Beteiligten wohl fühlen, führen diese Abstraktions-Versuche schnell ad absurdum.
Ähnlich schwierig zu akzeptieren scheint auch die Gleichgewichtung aller Tätigkeit außerhalb der Projektes zu sein. Es sollte schließlich egal sein, ob einzelne außerhalb des Projektes (freiwillig) an der Uni büffeln oder in der Badewanne mit einem Glas Sekt liegen und sich ein gutes Buch zu Gemüte führen. Diese Akzeptanz erfordert allerdings eine hohe Selbstverantwortung und ein gutes Reflexionsvermögen.
Hinzu kommt: Der Acker ist vor der Tür. Wir wohnen zwar in verschiedenen WGs, aber doch zusammen auf einem Hof, und die räumliche Nähe führt zu einem Gefühl sozialer Kontrolle, das die oben beschriebenen Tendenzen verstärkt. Wir bekommen schließlich alles von den anderen mit. Ob eine räumliche Distanz das Problem löst oder nicht vielmehr beiseite schiebt, bleibt dahingestellt. Eine Lösung wären klare Vereinbarungen (z.B. feste Tage und Zeiten, in denen man im Projekt tätig ist) und trotzdem ein flexibler Umgang damit (z.B. andere spontane Absprachen, wenn die Zeiten mal nicht passen), um den Bedürfnissen der einzelnen im Jetzt den angemessenen Respekt zu zollen. Dann kann kollektiv nach einer Problemlösung gesucht werden, statt individuelle Schuldzuweisungen und Selbstausbeutungs-Forderungen zu formulieren. Angenommen, eine_r von uns ist überlastet, dann kann so z.B. gemeinsam nach Mithilfe gesucht werden, um der_dem Betroffenen entsprechenden Freiraum zu gewähren. Dennoch bleibt diese Frage bestehen und muss kontinuierlich neu beantwortet werden: Wie stehen individuelle Bedürfnisse im Jetzt und Verantwortung für im Kollektiv getroffene Vereinbarungen zueinander? Klar ist beides wichtig. Eine Grenze ist allerdings überschritten, wenn selbstbestimmte Tätigkeit zu abstrakter, entfremdeter Arbeit wird und es Menschen dadurch mittelfristig schlecht geht.
Wenn Tätigkeit wieder zur abstrakten Arbeit wird (ein fließender Übergang?), wird „der Rest der Zeit“ schnell wieder zur „Freizeit“. Letzteres macht Spaß. Das erstere „muss getan werden“. Sollte die aktuelle „Arbeits“situation tatsächlich unerträglich sein, kann die Wiedereinführung dieser Trennung in Arbeit und Freizeit ein Rettungsanker sein. Eine Möglichkeit zu sagen: Bis hierher und nicht weiter. Dazu braucht es aber sehr wahrscheinlich die oben beschriebene Normierung von Zeit und Tätigkeit. Wenigstens für eine_n selbst: „Ich hab so und so viel gearbeitet – deshalb hab ich jetzt frei!„. Eine Überwindung dieser Trennung und ein konkretes Tätigsein statt einer abstrakten, entfremdeten Arbeit sollten aber weiterhin die Losung bleiben.
Auch in unserem Tätigsein können sich andere (z.B. feministische) Ansprüche verlieren. Wenn das Gemüse ruft und wir alle Hände voll zu tun haben, stellt sich stereotypes Verhalten ein und bleibt wenig Zeit, unsere Privilegien zu reflektieren und uns gegenseitig Fähigkeiten beizubringen, vor deren Aneignung wir sonst Scheu hätten. Oder ich (ein männlich sozialisierter Gärtner) habe den ganzen Tag auf dem Acker verbracht, komme zurück in meine WG und ärgere mich darüber, dass ich, gerade ich (!), es bin, der um neun Uhr Abends noch anfangen „muss“ (!) zu kochen und zu spülen, weil es niemand anderes gemacht hat. Als ob die anderen Mitbewohner_Innen nichts zu tun gehabt hätten. Wir wollen die geschlechtliche Arbeitsteilung (produktiv / „männliche“ vs. reproduktiv / „weibliche„) überwinden? Pustekuchen!
Allgemein sei auch noch angemerkt, dass Landnutzung, um sie fachlich gut und angepasst betreiben zu können, ein mehrjähriges Engagement verlangt, das in Zeiten steigender Flexibilisierung und Unverbindlichkeit nicht so leicht organisierbar ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheinen könnte. Wir haben uns im Kollektiv auch nur für ein Jahr zusammengetan.
In diesem Sinne abschließend noch ein kleiner Seitenhieb in Richtung Revolutionsromantiker: Selbstbestimmung und Selbstverantwortung entstehen also nicht automatisch mit dem Wegfall der kapitalistischen Strukturen. Dies ist zwar eine notwendige Voraussetzung. Hinreichend wird es aber erst, wenn wir uns vom Kapitalismus in unserem Kopf befreien. Und dies ist ein langwieriger, kollektiver genauso wie individueller Prozess.
Problemfeld 2: Lustprinzip und Verantwortung
Auch in einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft braucht es Verantwortung und Verbindlichkeit. Wir haben einer Gruppe von 60 Menschen zugesagt, für sie Gemüse zu produzieren. Damit rechnen sie. Zwar kann durch den weiterhin bestehenden Zugang zum kapitalistischen Markt ein Ernteausfall durch den Gang zum Supermarkt oder Container abgefedert werden. Aber die Vermeidung eines solchen Rückgriffs ist ja erklärtes Ziel des Projektes. Zwar ist anzunehmen, dass eine vernetzte, nicht-kapitalistische landwirtschaftliche Produktion entsprechende Lücken in der Versorgung durch Risikostreuung (verschiedene Anbaustandorte etc.) überbrücken kann. Aber (vielleicht) nicht, wenn alle Beteiligten (v.a. die Produzierenden) unbedingt dem Lustprinzip („Ich mach, wozu ich Lust habe.“) folgen. Das Lustprinzip kann zwar eine Leitlinie sein. Allerdings ist Landnutzung vor allem die Kunst, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Da kann die Witterung ein Handeln erzwingen, auf das mensch gerade keine Lust hat. Das erzeugt Druck. Druck, der aus gegenseitiger Abhängigkeit, Verantwortung und Verbindlichkeit und aus einem Arbeiten mit der Natur entsteht. Auch dieser wird in einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft nicht gänzlich verschwinden. Wir mussten uns dieses Jahr zum Beispiel durch eine beispiellose Trockenheit kämpfen: Die Pflanzen warten nicht darauf, bis jemand Lust hat, sie zu gießen. Sie vertrocknen einfach.
Diesen Druck erzeugen wir allerdings auch durch uns selbst. Lohnenswert bleibt deshalb darüber nachzudenken, welches Handeln wir gerade für unbedingt erforderlich halten und welches nicht. Wie weit wollen wir das Lustprinzip hinten runterfallen lassen? Was passiert mit meiner Lust, wenn alles vertrocknet und es nix mehr zu ernten gibt? Wie weit geht unsere Verantwortung für andere? Ähnlich wie bei der Balance zwischen Kollektiv und Individuum bleibt es auch bei Lustprinzip und Verantwortung ein Lernprozess, die Situationen richtig einzuschätzen und aus Fehlern zu lernen.
Problemfeld 3: Abhängigkeit vom Kapitalismus und die Frage nach dem technischen Niveau
Es ist leider unmöglich, das technische Niveau einer nicht-kapitalistischen landwirtschaftlichen Produktion abzusehen. Dafür müsste die Grundlage des technischen Potentials, nämlich die Rohstoffe dieser Erde, als globales Gemeingut eingerichtet werden. Dann könnte darüber verhandelt werden, ob überhaupt, wie und für welche Technik wir sie als Menschheit verwenden wollen. Die Ergebnisse dieses hypothetischen Aushandlungprozesses bleiben zwangsläufig unbekannt. Deshalb wird es zu dem Thema, welches technische Niveau einer nicht-kapitalistische Produktion angemessen ist, unterschiedlichste Einschätzungen geben.
Diese Unklarheit spielt in unserem landwirtschaftlichen Projekt folgendermaßen eine Rolle: Durch den Kauf moderner Technik greifen wir erstens auf die kapitalistische Gesellschaft und ihre Durchsetzungsmechanismen von Landraub, Vertreibung und Umweltzerstörung durch Rohstoffgewinnung und industrielle Produktion zurück. Deshalb können wir den Menschen, für deren Nahrungmittelversorgung wir Verantwortung übernehmen, nicht versprechen, dass es Traktoren und Landmaschinen in der heutigen Form in einer nicht-kapitalistischen Welt weiterhin geben wird. Schlimmer noch könnte es sein, dass das Wissen um weniger technisierte Anbauverfahren in der Zwischenzeit verloren geht und damit die Nahrungsmittelversorgung in Frage gestellt wird.
Ganz konkret entsteht durch den Rückgriff auf die kapitalistischen Durchsetzungsmechanismen besonders dann ein Bedürfniskonflikt, wenn ich mich nach Rationalisierung und effektiver „Arbeitswirtschaft“ statt „Selbstausbeutung“, durch arbeitserleichternde Landmaschinen sehne und sich auf der anderen Seite eine Bäuerin in Bergbaugebieten in Chile wünscht, dass ich dem kapitalistischen Zwangssystem, das ihre Lebensgrundlage zerstört, keinen Vorschub leiste, indem ich darauf basierende Waren kaufe.
Wollen oder können wir die Produktion von Landmaschinen nicht selbst organisieren, können wir dem Dilemma aus dem Weg gehen, indem wir die nicht-kapitalistische landwirtschaftliche Produktion mit wenig technisierten Verfahren organisieren und bei der Anschaffung neuer Geräte auf die lange Haltbarkeit, einfache Reparierbarkeit, Recycelbarkeit und Durchschaubarkeit der Technik achten sowie deren ökologische Verträglichkeit in Produktion und Nutzung sowie den Enfremdungsgrad für die Produzierenden und Nutzer_Innen prüfen. Die eventuell entstehende Mehrarbeit in einem wenig technisierten System könnte auch, wenn gewollt, von der Gemeinschaft um das Projektkollektiv erledigt werden, um einem Gefühl der Selbstausbeutung und Monotonie der Hauptproduzierenden vorzubeugen.
Ein weiterer Schritt, um die Abhängigkeit vom Kapitalismus zu mindern, wäre es, die laufenden Kosten zu minimieren, d.h. das Produktions-System unabhängiger von Geld-Inputs zu machen. Größere Investitionen in Infrastruktur sollten dann nur getätigt werden, wenn sie uns langfristig unabhängiger von Geld-Inputs machen: ausgeklügelte Handmaschinen, Ölpressen zur Kraftstoffgewinnung, Infrastruktur/Geräte zur eigenen Saatgut-Gewinnung; oder andere Betriebe in das Netzwerk integrieren, die diese Möglichkeiten haben.
Problemfeld 4: Fehlende Selbstorganisation im Netzwerk und Erweiterung des Konzeptes
Genauso wie wir Gärtner_innen in unserem Tätigsein Aspekte der „arbeits-wahnsinnigen„ Gesellschaft verinnerlicht haben, so haben die “Begärtnerten„ sehr wahrscheinlich eine Konsumhaltung verinnerlicht. Gerade auch der freiwillige, monatliche finanzielle Beitrag kann diese Haltung verstärken. Während sich einige eine weitreichende Selbstorganisation als radikales Experiment gegen den Kapitalismus wünschen, ist anderen die “alternativen Gemüsebeschaffungsmaßnahme„ revolutionär genug. Wichtig, um Enttäuschungen durch diese Tendenz vorzubeugen, kann die Formulierung der gemeinsamen Vision sein und darauf folgend die selbstbestimmte, aber verantwortliche Übernahme von anfallenden Aufgaben (in der oder um die Produktion herum) je nach den Fähigkeiten und Wünschen der “Begärtnerten„. In diesem Dialog können dann auch Hindernisse auf dem Weg der Selbstorganisation (Prioritätensetzung, Zeit- und / oder Geldmangel, fehlende Transparenz, Unlust etc.) gemeinsam beschrieben und überwunden werden.
Wenn die Vision auch eine Ausweitung der schenkökonomischen Prinzipien auf andere Lebensbereiche beinhaltet, macht es Sinn, eine Vernetzung mit anderen umsonstökonomischen Projekten anzustreben und zu forcieren. Innerhalb des Projektes wäre es weiterhin auch möglich, die Bedürfnis-Befriedigung der „Produzierenden“(d.h. uns Gärtner_innen), nicht durch Geld, sondern durch die Fähigkeiten der Gemeinschaft zu decken. So könnte ein Begärtnerter, der gleichzeitig Arzt ist, andere in der Gemeinschaft, vor allem aber die Gärtner_innen, umsonst behandeln. Oder der Schlosser im Netzwerk könnte unsere Maschinen umsonst reparieren. Damit werden scheinbar erst mal unvermeidbare finanzielle Kosten (hier z. B. Geld für Krankenversicherung oder Werkstattkosten) irgendwann wegfallen.
Problemfeld 5: Investitionen in und Zugang zu Produktionsmitteln
Das oben beschriebene Budget beinhaltet weder den Kauf von Hof und Land noch die Investition in teurere Produktionsmittel. Hierfür müssen Lösungen gefunden werden: Zum Beispiel durch das Abschreiben und Einbeziehen der Investitionen in das Budget oder die Einrichtung eines Fonds für nicht-kapitalistische Projekte, in den geneigte und betuchte Menschen Gelder investieren, die dann entweder eine Sicherheit für Kredite bieten oder direkt für den Kauf von Produktionsmitteln verwendet werden. Beispiele dafür gibt es z.B. in Frankreich.
Diese Produktionsmittel sollten dann für ein langfristig angelegtes nicht-kapitalistisches Experiment unumkehrbar entprivatisiert werden. Dafür braucht es eine Rechtsform, die genau diese nicht-kapitalistische, ökologischen Nutzungsbestimmungen festschreibt und verankert. Dies würde auch der Forderung Rechnung tragen, dass Land von jenen bewirtschaftet werden sollte, die es am ehesten im Einklang mit den Bedürfnissen der zu versorgenden Gemeinschaft und den ökologischen Gesetzmäßigkeiten nutzen.
Problemfeld 6: Der Zugang zu den zur Zeit begrenzten nicht-kapitalistischen Erzeugnissen
Ähnlich wichtig wäre die Beantwortung der Frage danach, wer Zugang zu den nicht-kapitalistischen landwirtschaftlichen Erzeugnissen bekommt. Nicht-kapitalistisches Gemüse ist unter jetzigen Verhältnissen ein begrenztes Gut. Die Wartelisten von uns ähnlichen Höfen zeigen auch, dass sich das Problem nicht „einfach“ bzw. kurzfristig mit der „Neugründung weiterer Projekte“ oder der „Vergrößerung“ bestehender Projekte lösen lässt. Dies wäre die ideale Lösung und ihr sollte die meiste Energie zufließen.
Wer hat also Zugang zu den Erzeugnissen? Diejenigen, die als erste da waren? Die mit den besseren persönlichen Connections? Auf jeden Fall nicht (nur) diejenigen, die (am meisten) zahlen? Oder jene, die die brauchbarsten Fähigkeiten einbringen? Wohl eher auch nicht. Schließlich geht es um die Entkoppelung von Geben und Nehmen. Ohne die Frage abschließend beantworten zu können, bleibt klar: Das finanzielle Budget des Projektes muss gedeckt werden. Und alle Beteiligten sollen glücklich sein. Im Ergebnis wohl ein weiterer Aushandlungsprozess.
Eine weitere Frage des Zugangs stellt sich, wenn wir reflektieren, dass unser Projekt zumeist aus Menschen der weißen Ober- und Mittelklasse besteht. Was ist mit sozial Ausgegrenzten? Wir stellen unser Gemüse zwar auch illegalisierten Migrant_innen in der Umgebung zur Verfügung. Diese sind allerdings nicht organisiert, wurden an den Stadtrand gedrängt, und es bestehen deshalb Barrieren auf Grund fehlender Mobilität (keine Fahrräder, kein Geld für die Öffentlichen), sozialer Isolation und auch unterschiedlicher Sprachen. Die Abholung und Verteilung der Produkte steht und fällt deshalb mit den wenigen Migrant_innen, bei denen diese Barrieren überwindbar sind und zu denen wir deshalb einen Kontakt aufbauen konnten. Hier wäre kontinuierlicher Austausch mit den Menschen vor Ort nötig. Einfacher hingegen könnte die Arbeit mit organisierten Zusammenhängen sein (z.B. Erwerblosen- und Flüchtlingsinitiativen), zu denen wir Kontakt aufzubauen versuchen.
Die Zukunft. Kommende Herausforderungen
Überzeugt von dem Potential dieser Idee erwarten wir, dass sich in Zukunft Fragen nach der Erweiterung auf zwei Ebenen stellen.
Wir könnten regional mehr Gemüse und auch mehr Produkte nach diesem Modell organisieren. Hier sind Imker_innen und Obstbäuer_innen bereits am Grübeln. Allerdings stellt sich die Frage der Organisierung neu, wenn immer mehr Menschen in einer Region Teil des Projektes werden. Wie können wir uns in Großgruppen methodisch organisieren? Ab wann müssen wir uns aufteilen und wollen wir delegieren?
Außerdem könnten wir uns überregional umschauen, wo unser Wein und unsere Avocados herkommen könnten. Wer stellt diese zu Verfügung? Was für Bedürfnisse haben deren Produzent_innen? Können wir dazu irgendetwas beitragen? Wird es dann nicht wieder zum Tausch? Kohl wollen sie in Spanien als Gegenleistung doch eh nicht haben.
Wenn die beschriebene Gegenseitigkeit also weiter ausgedehnt werden soll, wird es umso komplizierter. Es stellen sich ganze neue Fragen der Organisierung, Bedarfserfassung, Logistik, Ausstattung und Finanzierung. Fragen also, die wohl am besten im Tun beantwortet werden können.
Abschließend sei auch noch auf das „Netzwerk Solidarische Landwirtschaft“ hingewiesen (www.solidarische-landwirtschaft.org/), dass versucht bestehende, ähnliche Projekte zu vernetzen, Neugründungen zu unterstützen und die Idee in der Öffentlichkeit bekannter zu machen.
Endliche Ressourcen als Gemeingut
Was wäre wenn … wir über die Nutzung von Bodenschätzen global, gemeinsam und gleichberechtigt entschieden?
Definition
Bodenschätze, also alle endlichen Ressourcen dieses Planeten, sind prädestiniert dafür als Gemeingut zu gelten. Ob, wie und wofür diese gewonnen und genutzt werden, sollte von der gesamten Menschheit kollektiv in einem gleichberechtigten Prozess ausgehandelt werden.
Denn die regionale Verteilung dieser Stoffe ist zufällig, ungleich und ihre Vorkommen begrenzt. Es wäre daher absurd, nur denen eine Nutzung zu ermöglichen, die zufällig in dieser Region leben. Denn das Bedürfnis zur Nutzung dieser Ressourcen ist global. Diese Kombination aus breitem Interesse und Begrenztheit lässt Interessenkonflikte wahrscheinlich werden und verlangt deshalb umso mehr nach einer kooperativen und gleichberechtigten Aushandlung.
Diese Begrenztheit verlangt ebenfalls, dass die Ressourcen zwar genutzt werden können aber so verarbeitet werden sollten, dass sie nicht verbraucht, sondern trotz der temporären Verwendung, langfristig (d.h. möglichst unverändert) und unkompliziert (d.h. ohne großen energetischen oder technischen Aufwand) wieder zurück gewonnen werden können.
Eine Möglichkeit zur Lösung der Mengenfrage, wäre, die Nutzungsrechte der zur Zeit nutzbaren endlichen Ressourcen anteilig und gleichmäßig auf alle Menschen aufzuteilen. Damit hätten dann einzelne Menschen individuell und ihre Gemeinschaften kollektiv ein Budget an Ressourcen, das sie nutzen „dürfen“. Wofür und für wen sie diese Nutzen wollen oder ob sie ihre Anteile zusammenlegen oder anderen zur Verfügung stellen wollen, könnte dann auf kleinerer Ebene entschieden werden.
Auch ist anzumerken, dass der Abbau endlicher Ressourcen erhebliche Verwüstungen ganzer Landstriche in der betroffenen Region verursacht und damit extreme ökologische und soziale Schäden anrichtet. Die Leidtragenden sind hier zu aller erst die dortigen Ökosysteme und die darin lebenden Menschen. Für sie geht es nicht einfach „nur“ um Teilhabe an der Nutzung der Ressource sondern um die existenzielle Beeinträchtigung ihrer Lebensgrundlage und Lebensumwelt durch Abbau und Begleitprozesse.
Erarbeitung von Vorschlägen für diesen globale Aushandlungs-Prozesses
Für diesen globalen Aushandlungsprozess müssen Menschen individuell und kollektiv in ihren Gemeinschaften grundsätzliche Fragen klären: Wie und mit welcher Technik möchte ich meine Bedürfnisse und die dafür nötige Produktion organisieren? Wie viele endliche Ressourcen benötigen ich oder wir dafür? Wie erreichen wie optimale Möglichkeiten zur Wiederverwertung? Und vorausgesetzt, es gibt ein globales Interesse an der Nutzung der aus den Ressourcen produzierten Gütern: Ist deren Produktion bzw. der daraus erwachsende Nutzen verallgemeinerbar? Wenn nein: Wie bekommen wir ein ähnlich zufriedenstellendes Resultat mit geringerem Ressourcen-Bedarf?
Gibt es demnach Ideen und Interesse zur Nutzung bestimmter Ressourcen, müssen weitere Fragen geklärt werden. Wer organisiert den Produktionsprozess von der Rohstoffgewinnung bis zum fertigen Produkt? Wie kann diese Produktion (insbesondere der Abbau) mit möglichst wenig Schaden organisiert werden? Sinnvoll wäre es bereits zu diesem Zeitpunkt zu überlegen, woher mensch die benötigten Stoffen bekommt, um im Vorhinein Vereinbarungen und Absprachen zu den Details des Abbaus mit den Bewohner_Innen der betroffenen Regionen zu finden.
Durch die Beantwortung dieser sicherlich nicht erschöpfenden Fragen können dann konkrete Vorschläge und Ideen ausgearbeitet, die dann in Kooperation mit anderen Menschen umgesetzt werden können Ablauf des Aushandlungs-Prozesses
Hat eine Projektgruppen dann alles für ihre Unternehmung zusammen, ist es notwendig, dass das Vorhaben global transparent gemacht wird. Diese Beschreibung sollte enthalten inwiefern das Produkt die oben genannten Kritierien (Notwendigkeit zur Bedürfnisbefriedigung, weitgehende Reduzierung des Ressourcenverbrauchs/ Verallgemeinerbarkeit, Recycelbarkeit, Langlebigkeit und Reparierbarkeit) erfüllt. Des weiteren sollte ersichtlich sein, dass die benötigten Stoffe noch im oben genannten „Ressourcen-Budget“ der Beteiligten und Nutzer_Innen „drin sind“. Dies würde die globale Klasse der „Hochindustrialisierten“ erstmals ausschließen bis diese ihren Verbrauch drastisch reduziert haben.
Dieses Vorgehen ermöglicht einen offene Prozess in dem andere Interessierte oder Betroffene, Verbesserungen, Vorschläge, Kritik oder andere Anmerkungen einbringen könnten. Sicher werden einige Vorschlägen Kontroversen und direkte Interventionen erzeugen. Die Ergebnisse wären aus heutiger Perspektive nicht vorhersehbar. Sicher scheint, dass durch diesen Prozess die Ressourcennutzung gründlich umgekrempelt würde. Nicht zuletzt weil darin auf die Bedürfnisse der regionalen Gemeinschaften in den Abbaugebieten besonders berücksichtigt würden. Dieses von Initiative und Intervention geprägte System bliebe dynamisch genug um die menschliche Kreativität nicht unnötig zu hemmen. Die Produktion organisieren jene, die ein Interesse an den Produkten haben.
Spätestens jetzt stellt sich allerdings bei diesem Prozess, wie bei viele anderen globalen Problemen, die Frage, wie und wo dieser Aushandlungsprozess und die Bekanntgabe der Vorschläge denn von statten gehen soll. Das Internet könnte hier vielleicht die nötige Transparenz und in geringerem Umfang die nötige Kommunikation schaffen. Allerdings müsste dafür zu aller erst die globale IT-Infrastruktur und dessen endlicher Ressourcen-Verbrauch an sich verhandelt werden.
Für alle konkreteren Schritte der Umsetzung bleiben wahrscheinlich weiterhin andere, direktere Kommunktionsformen (von Telefon, Radio bis physischen Treffen von Interessierten oder Betroffenen ist alles denkbar) nötig, deren Nutzung sehr wahrscheinlich mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, um die Fülle an Informationen auszutauschen. Ob und wie die Beschaffenheit dieses Aushandlungsprozesses die Nutzung der Ressourcen und die daraus entwickelte Technik verändert, bleibt abzuwarten.
Es bleibt zu hoffen, dass alle Beteiligten in diesen komplexen Prozess mit ausreichend Selbstreflektion und Selbstorganisationsvermögen einsteigen.
Fazit und praktische Konsequenzen für die Selbstorganisation im Hier und Jetzt
Wenn wir darüber nachdenken, eine schenkökonomische Produktion zu organisieren, kommen wir um die Frage der endlichen Ressourcen nicht herum. Konsequent wäre es eigentlich mit der Organisierung dieses Ursprungs jeglicher Produktion zu beginnen. Erst in diesem Prozess könnte sich dann das technische Niveau einer selbstorganisierten Produktion abzeichnen. Zum Beispiel ob und in welcher Form die sogenannten „erneuerbaren Energien“ (die ja in Produktion und Leitungsnetzen auch auf endlichen Ressouren basieren) eine Rolle spielen. Alles andere bleibt Spekulation.
Die Diskussion zeigt allerdings auch die Notwendigkeit von Technik, die komplett auf erneuerbaren Ressourcen basiert. Weitere Kriterien für eine emanzipatorische Technikentwicklung könnten die einfache Recycelbarkeit und eine möglichst lange Lebensdauer aller Produkte sein. Entscheidet man sich für die vereinfachte Version, in der allen Menschen ein fairer Teil der globalen Ressourcen zugeteilt wird, ist absehbar, dass sich zum Beispiel der bundesdeutsche Ressourcenverbrauch auf 1/10 des jetzigen Niveaus absenken müsste.
All dies gilt es in der Öffentlichkeit, aber vor allem auch in den diversen sozialen Bewegungen bewusst zu machen. Ganz konkret gilt es auch, sich mit dem Widerstand gegen den zerstörerischen Abbau von endlichen Ressourcen, vor allem auch im globale Süden, zu solidarisieren und eigene direkte Aktionen gegen die entsprechenden Akteure zu starten.
 Eigentlich war das Seminar schon für letztes Jahr geplant, doch da musste es wegen schwerer Erkrankung meines Ko-Referenten kurzfristig abgesagt werden. In vier Wochen ist der Nachholtermin:
Eigentlich war das Seminar schon für letztes Jahr geplant, doch da musste es wegen schwerer Erkrankung meines Ko-Referenten kurzfristig abgesagt werden. In vier Wochen ist der Nachholtermin: Summary of the characteristics of peer production, first part using
Summary of the characteristics of peer production, first part using  Lothar Galow-Bergemann hat am passenden Ort (im Karl-Marx-Haus in Trier) einen
Lothar Galow-Bergemann hat am passenden Ort (im Karl-Marx-Haus in Trier) einen