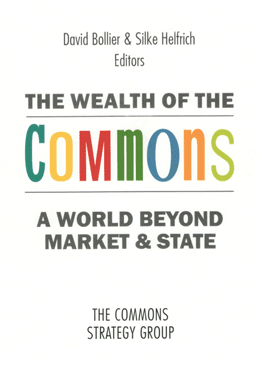“Post-Kapitalistische” oder “Nicht-Kommerzielle” Landwirtschaft?
 Im Umfeld der Projektwerkstatt auf Gegenseitig (PAG) trifft sich regelmäßig ein Kreis von Menschen aus verschiedene Projekte die sich dem nicht ganz klar definierten Konzept der “Nicht-Kommerzialität” (NK) verbunden fühlen und sich auf diesen Treffen vernetzen und austauschen. Eins der bekanntesten Projekte aus diesem Umfeld ist wohl die “Nicht-Kommerzielle Landwirtschaft” wie sie auf dem Karlshof bei Berlin von einer Hofgruppe und nach deren Scheitern von einer freien Assoziation von Menschen aus dem Karlshof-Umfeld organisiert wurde. Die Unterschiede diese Praxis zur vielfältig umgesetzten Community Supported Agriculture (CSA) bzw. Solidarischen Landwirtschaft werden dort immer wieder kontrovers diskutiert. Bei mir als Mitglied der CSA Freudenthal, einem solchen post-kapitalistischen Landwirtschafts-Experiment, regen diese kritischen Diskussionen immer wieder die Reflektion über das eigene Projekt an. Einige Aspekte dieser Kritik an unserem Projekt und meine Entgegnungen seien hier skizziert.
Im Umfeld der Projektwerkstatt auf Gegenseitig (PAG) trifft sich regelmäßig ein Kreis von Menschen aus verschiedene Projekte die sich dem nicht ganz klar definierten Konzept der “Nicht-Kommerzialität” (NK) verbunden fühlen und sich auf diesen Treffen vernetzen und austauschen. Eins der bekanntesten Projekte aus diesem Umfeld ist wohl die “Nicht-Kommerzielle Landwirtschaft” wie sie auf dem Karlshof bei Berlin von einer Hofgruppe und nach deren Scheitern von einer freien Assoziation von Menschen aus dem Karlshof-Umfeld organisiert wurde. Die Unterschiede diese Praxis zur vielfältig umgesetzten Community Supported Agriculture (CSA) bzw. Solidarischen Landwirtschaft werden dort immer wieder kontrovers diskutiert. Bei mir als Mitglied der CSA Freudenthal, einem solchen post-kapitalistischen Landwirtschafts-Experiment, regen diese kritischen Diskussionen immer wieder die Reflektion über das eigene Projekt an. Einige Aspekte dieser Kritik an unserem Projekt und meine Entgegnungen seien hier skizziert.
Zum besseren Verständnis seien die vorherige Lektüre folgender zwei Artikel und der folgende Vortrag empfohlen:
Post-Revolutionäre Möhre
Post-Kapitalistische Landwirtschaft – Potentiale, Probleme, Perspektiven
Post-Kapitalistische Landwirtschaft – Die Zweite
Zum Konzept der “Nicht-Kommerzielle Landwirtschaft” gibt es auch einige Texte:
Keimform-Eintrag
Grundlegendes Statement der alten Hofgruppe
Message zum Ende der NKL 2012
taz-Artikel
NKL – Ein Erfahrungsbericht – Die erste 3 Jahre
Freitag-Artikel
Greenpeace-Magazin-Artikel
Schafft unser Projekt zu wenig Raum für emanzipatorische Prozesse im Kollektiv?
In der “Nicht-Kommerziellen Landwirtschaft” wird viel Wert auf das Lustprinzip, das Wahrnehmen eigener Bedürfnisse und eine Reflektion verinnerlicheter kapitalistischer und diskriminerender Verhaltensweisen gelegt. Die Produktion und deren Output wird diesem Prozess klar untergeordnet. In unserem Projekt ist zwar ein definierter Output nötig, weil wir uns verpflichtet haben, eine Gruppe von Menschen mit Gemüse zu versorgen (s.u.). Aber dies Verunmöglicht nicht einen solchen Emanzipationsprozess. Ob er stattfindet liegt an der Organisierung des jeweiligen Kollektives. Ein emanzipatorischer Produktions-Prozess braucht Zeit (z.B. für gender-spezifische Schutzräume und Reflektionen), Langsamkeit und Achtsamkeit. Dies kann und wird auch in unserem Projekt organisiert: Das dafür benötigte Mehr an Zeit kann bei der Anbauplanung und der Zusammensetzung des Kollektivs berücksichtigt werden. Ebenso kann dieser Emanzpations-Prozess als Ziel in die Gründungsvereinbarung mit aufgenommen werden und erhält damit einen ähnlichen Stellenwert wie der materielle Output an Gemüse. Dies beantwortet auch die Frage nach den Erwartungen der Unterstützer*Innen: Klar erwarten diese eine Vollversorgung mit Gemüse. Aber in der Vereinbarung kann klar festgehalten werden unter welchen “Arbeits”-Bedingungen diese zu Stande kommen soll; und unter welchen besser nicht.
In den wöchentlichen Kollektiv-Treffen wird bzw. kann sich ebenfalls bewusst Zeit dafür genommen werden, zu brainstormen was für unerwünschte Dynamiken im Tätigsein aufgetaucht sind oder welche befürchtet werden, um einen bewussten Umgang damit zu ermöglichen. Letztlich bleibt anzumerken, dass nicht nur der Druck zum Produzieren zwangsläufig der Grund für blödes, herrschaftsförmiges Verhalten ist, sondern genausogut verinnerlichte Logiken, die auch in einem “freien” Rahmen zu den gleichen Dynamiken führen (mackrigem Verhalten, Konkurrenz, gegenseitiges Vergleichen etc.). Die Reflektionsbereitschaft der Beteiligten scheint mir in allen Fällen als Schlüssel zur Emanzipation.
Erzeugt die Verpflichtung zur Gemüse-Versorgung gefährliche “Sachzwänge”?
Die Skepsis der oben beschriebene Verpflichtung den Unterstützer*Innen gegenüber rührt oft aus der Sorge vor Sachzwängen. Dabei kann diese Versorgungs-Verpflichtung den Unterstützer*Innen gegenüber genausogut eine enorme Motivation sein, Streitereien, Konflikte und blöden Dynamiken emanzipatorisch anzugehen, statt sie “auszusitzen”. Mehr noch könnte es gerade in “freien Situation” ohne Verpflichtung auch dazu kommen, dass sich Menschen aus schwierigen Situationen früher raus- oder zurück ziehen und damit persönliche, zwischenmenschliche Herausforderungen in Sachen Ermächtigung und Emanzipation nicht annehmen. Diese Verbindlichkeit auf der zwischenmenschlichen Beziehungsebene in unserem Projekt (in der Gesamt-Gemeinschaft als auch im Gärtner*Innen-Kollektiv intern) kann auch gewollt sein, weil sie der Marktlogik mit ihrer Unverbindlichkeit, Beliebigkeit und Flexibilisierung etwas entgegen setzt. Trotzdem braucht es die Möglichkeit sich aus unerträglichen Situationen raus ziehen zu können. Dafür sind die von uns frei definierte Scheiterkriterien für das Projekt und das Kollektiv enorm wichtig. Sie erlauben nicht “alles aushalten zu müssen”.
Außerdem ist die politische Wirkmächtigkeit der Ernährungsautonomie die nur mir dieser Versorgungs-Verpflichtung gewährleistet werden kann, nicht zu vernachlässigen. Denn die sichere Nahrungsmittel-Versorgung von Menschen jenseits der kapitalistischen Vergesellschaftung ist ein politischer Anspruch, der kaum hoch genug bewertet werden kann. Diese Verlässlichkeit jenseits des Marktes ist ein starkes gesellschaftspolitisches Statement.
Und schließlich: Empfundene “Zwänge” wird es wahrscheinlich immer geben. Auch in einer post-kapitalistischen Ökonomie. Die aus Kooperation entstehende Verbindlichket anderen Menschen gegenüber und speziell in der Landwirtschaft das Wetter, eine damit eng verknüpfte gute, fachliche, agrarökologische Praxis und ein Verantwortungsgefühl dem Boden und dessen Fruchtbarkeit gegenüber sind Faktoren die einen Druck ausüben. Die Bodenfruchbarkeit durch richtige Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt zu steigern oder dem Wettertakt zu folgen können ebenso als besonders befriedigend erlebt werden. Je nach eigenem Charakter und Rahmenbedingungen.
Welche unerwünschten Dynamiken entstehen durch die finanzielle Reproduktion der Kollektiv-Mitglieder durch das Projekt?
Meine These diesbezüglich wäre: Unser CSA-System ist eine Form den Lebenunterhalt zu sichern ohne entfremdende Zwänge von außen. Die Abdeckung des eigenen finanziellen Bedarfs (“Lohn”), ein Jahr im Voraus, kann eine unglaubliche Motivation und Entlastung sein die Freude am Tun gibt. Ich halte es für wahrscheinlich, dass eine marktförmige Tätigkeit außerhalb des Projektes, um die Kohle zum Leben ranzuschaffen, in Durchschnitt und Summe zu mehr Entfremdung führt. Der “Lohn” führt unserer Erfahrung nach ausschließlich zu entlastenden Dynamiken. Sollte durch den “Lohn” in unserem Projekt doch ein Druck entstehen (“Ich muss arbeiten weil ich Geld kriege.”), dann hat dieser viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Denn je nach eigenem Selbstwertgefühl sagt mensch entweder “Ich muss erst arbeiten damit ich Leben darf.” oder “Ich habe ein Recht auf gutes Leben! Jenseits meines Tuns!”. Daran ist aber nicht der “Lohn” Schuld. Diesen Selbstwert zu erlangen und Selbsticherheit im Forumlieren der eigenen Bedürfnisse zu erlernen sind einige der vielen Dinge die die Mitwirkung am Kollektiv ermöglicht.
Den Lebensunterhalt außerhalb sichern kann dazu führen, dass nur Menschen mit am Markt verwertbarer Arbeitskraft, Fähigkeiten oder Connections zu Geld-Überflüssen die Möglichkeiten dazu haben NK-Projekte zu machen ohne dabei zu verhungern, oder sich extrem entfremden oder verbiegen müssen für die Sicherung des eigenen Lebensunterhaltes: Was das Ganze dann ad-absurdum führen würde. Das Bäuer*Innen durch Ihre Tätigkeit seine*ihre (finanzielle) Reproduktion sichern können und ihre Bedürfnisse in den Fokus des Projektes gestellt werden ist erklärtes politisches Ziel unseres Projektes und überwindet die heutigen gesellschaftlichen Realitäten.
Im Endeffekt ist Geld immer dreckig. Egal wo es herkommt. Und die meisten anti-kapitalistischen Projekte haben bisher nur Inselcharakter im Geldstrom. Und sollte es daher darum gehen diese Inseln in der Summe als möglichst entfremdungsfreie und nicht-marktförmige Räume zu gestalten.
Führen Arbeitsteilung, Effizienz und Professionalität zu unerwünschten Dynamiken?
Ich verstehe unter effizientem arbeiten das Gefühl, dass es “flutscht”, das die Tätigkeit leicht von der Hand geht, das was “weggerockt” wird und dabei alle Spaß haben. Aus dieser Perspektive sind Optimierung und Effizienzsteigerung von Arbeitsabläufen nicht per se Böse. Sie hängen nicht zwangsläufig der Verwertungslogik an. Genauso wenig geht es aber darum immer besonders schnelle, rationalisierte Arbeitsabläufe zu schaffen (wie im Kapitalismus). Ob und was mechanisiert wird; oder in wie weit im Kollektiv die Verantwortungen aufgeteilt werden liegt an den Wünschen der Gruppe. Unser Projekt ermöglicht über all dies frei zu entscheiden. Beispielsweise wurden die gemeinschaftlichen Ernte-Aktionen von Zwiebeln und Kartoffeln als besonders wertvoll für den Zusammenhalt im Projekt erachtet. Aus dieser Perspektive macht es dann wohl kaum Sinn einen Zwiebelvollernter anzuschaffen.
“Professionalität” hat aus meiner Einschätzung etwas damit zu tun das jemand eine Tätigkeit auf eine bestimmte Art und Weise gelernt hat; und ein umfangreiches Fachwissen besitzt. Es kann zum Beispiel dazu führen, dass eine Person versucht besonders schnell und rational zu ernten. Solange diese Arten und zu Weisen tätig zu sein aber nicht zu Norm erhoben werden denen sich andere dann ungewollt anzupassen haben bleibt dies eine individuelle Frage; die nichts desto trotz wichtig ist: Welche Arbeitsweisen habe ich meiner fachlichen Ausbildung gelernt, wie schätze ich diese ein, welche Konsequenzen haben sie für mich und andere. Finde ich sie förderlich oder will ich sie ablegen?
Letztlich geht diese Spezialisierung einher mit einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Beides ist notwendig. Denn es wird kaum möglich sein, dass sich Menschen in alle Produktionsprozesse die für das eigene Leben nötig sind einbringen und diese mitgestalten. Wissenshierarchien sind daher wohl unvermeidbar. Die Schlüsselfrage ist der Umgang damit. Ich bin überzeugt davon, dass es immer genug Menschen geben wird, die Spaß daran haben ihr Wissen anderen zu vermitteln, was wiederum andere entlastet die auf diese Wissensvermittlung keine Lust haben.
Bei uns ist die Partizipation der Unterstützer*Innen auf allen Ebene und in unterschiedlichster Verbindlichkeit erwünscht. Hier kommt es aber auch auf die Initiative aus dem Unterstützer*Innen-Kreis. Von Mitmach-Tagen bis festen und kontinuierlichen Mitwirkenden ist alles möglich. Auch dies hilft dabei Kehrseiten von Arbeitsteilung und Spezialisierung aufzuheben.
Reflektion des Konzeptes der “Nicht-Kommerzialtät”
Es kann nicht darum gehen nach dem “einen” Konzept zu Suchen. Vielmehr ermöglicht die Vielfalt an post-kapitalistischen Ansätzen ein Mitwirken ganz unterschiedlicher Charaktere an Keimform-Projekten. Dennoch stellt sich immer wieder die Fragen mit welchen Ansätzen welche Logiken überwunden werden könnnen. In diesem Sinne spielen die oben formulierte Reflektionen den Ball zurück an die Verfechter*Innen der “Nicht-Kommerzialtät” und hinterfragen implizit auch teilweise dessen Potential tatsächlich über die kapitalistische Vergesellschaftung hinaus zu weisen.